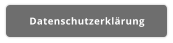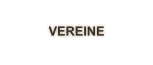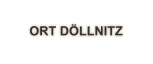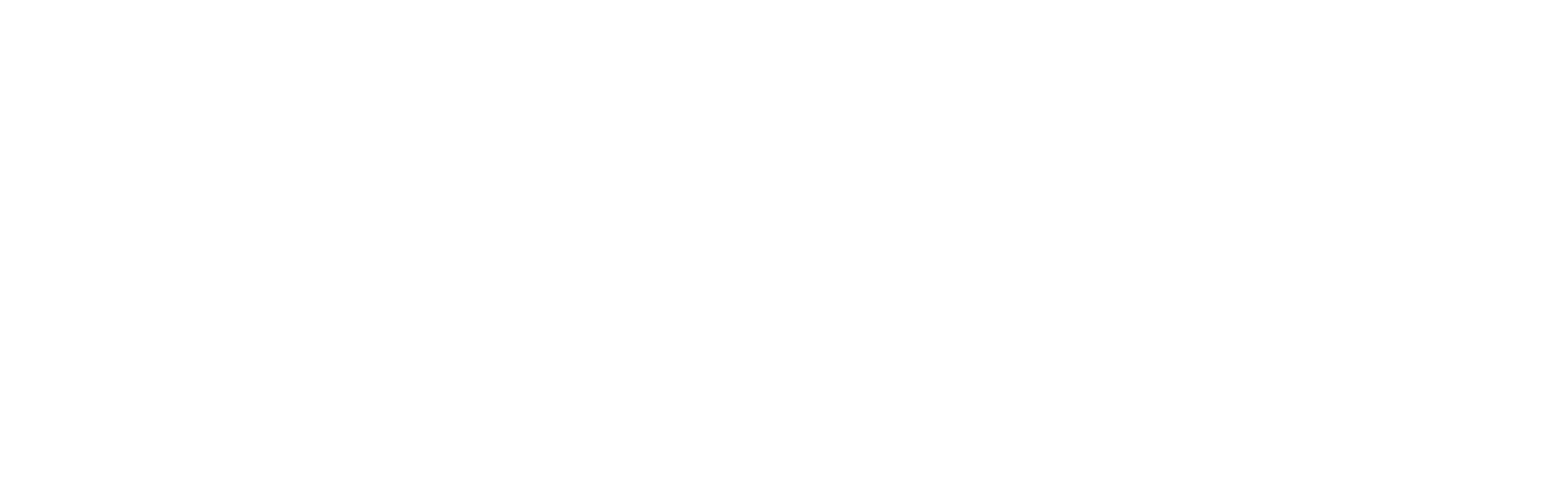
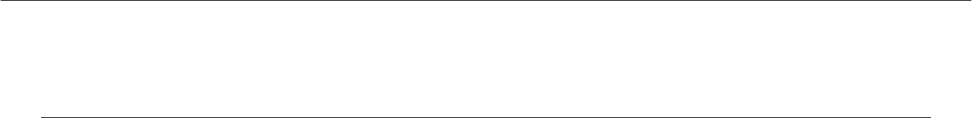

© Design Hartl Torsten PRO Döllnitz, Stand 02.2020
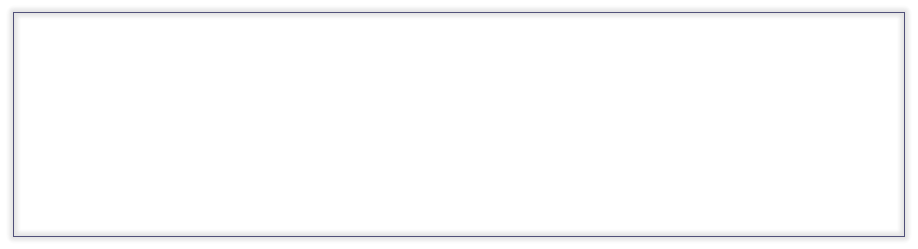
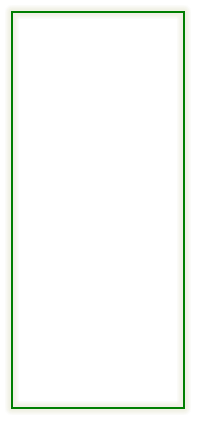

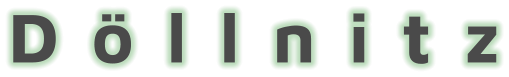


Der
Ortsteil
Döllnitz
liegt
an
der
"Weißen
Elster"
und
hat
1213
Einwohner
(Stand:
22.03.2018).
In
der
Aue
ist
das
ausgedehnteste,
mit
offenen
Wasserflächen
durchsetze
Schilfgebiet
des
Saalekreises
zu
finden,
ein
Refugium
seltener
Pflanzen-
und
Vogelarten,
so
z.B.
der
Seeadler.
Zum
Ortsbild
von
Döllnitz
gehören
von
je
her
die
Störche.
In
jedem
Jahr
werden
die
Ankömmlinge
von
vielen
Einwohnern
erwartet
und
beobachtet.
Döllnitz
wurde
erstmals
in
einer
Urkunde
von
1091
als
Bauerndorf
Tholenici
im
Burgwardbezirk
Schkeuditz
erwähnt.
Der
Ort
wurde
aufgrund
seiner
"niedrigen
Lage"
von
den
Sorben
benannt.
Der
Name
setzt
sich
zusammen
aus
dol
"Tal,
Niederung"
+
ici,
ein
Suffix,
der
"Ansiedlung,
Ort"
bedeutet.
Die
Wenden
drangen
im
Zuge
der
Völkerwanderung
um
das
Jahr
600
bis
an
die
Saale
vor.
Daher
ist
anzunehmen,
dass
der
Ort
zwischen
dem
7.und
8.
Jh.
gegründet
wurde.
Ab
dem
11.
Jh.
kam
es
zu
mehrmaligen
Besitzverschiebungen
zwischen
Magdeburg
und
Merseburg.
Das
Rittergut
hat
für
Döllnitz
immer
eine
große
Bedeutung
gehabt.
Mitte
des
18
Jh.
war
das
Gut
eines
der
bedeutendsten
im
Saalkreis.
1812
kaufte
J.
G.
Goedecke
das
Rittergut.
Es
entstanden
auch
eine
Ziegelei,
eine
Kohlengrube
sowie
eine
Mälzerei
und
eine
Brauerei.
Oberhalb
des
Rittergutes
an
der
Elster
steht
eine
aus
dem
Mittelalter
stammende
Wassermühle,
die
als
Mahl-
und
Ölmühle
diente.
In
der
Brauerei
des
Rittergutes
Döllnitz
wurde
seit
1824
eine
neue
Biersorte,
die
"Gose",
gebraut.
Der
aus
Goslar
zugereiste
Braumeister
Ledermann
braute
dort
das
nach
dem
Flüsschen
Gose
bei
Goslar
benannte
Bier,
wodurch
Döllnitz
als
"Gosen-Dorf"
zu
neuer
Berühmtheit gelangte.

Zeittafel an der Außenmauer des
Kulturgarten von Döllnitz
DÖLLNITZ
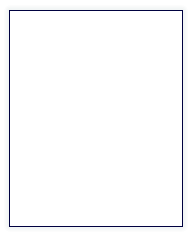

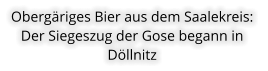
Die Gose trat von Döllnitz aus ihren Siegeszug an. Auch unter Soldaten
war das seit 1824 im Ort gebraute Bier sehr beleibt.
Seine
große
Industriegeschichte
kann
man
dem
beschaulichen
Örtchen
Döllnitz
an
der
Weißen
Elster
heute
kaum
mehr
ansehen.
Dabei
wurde
in
dem
heutigen
Schkopauer
Ortsteils
vor
fast
200
Jahren
ein
Stück
Geschichte
geschrieben:
Ein
Brauknecht
namens
Philipp
Ledermann
kam
1824
in
die
Gegend.
Im
Gepäck
hatte
er
das
Rezept
für
ein
neues
obergäriges
Bier,
das
nach
dem
Flüsschen
seiner
Heimatstadt
Goslar,
der
Gose,
benannt
wurde.
„Durch
eine
glückliche
Fügung
kam
er
nach
Döllnitz,
wo
der
Braumeister
des
Ritterguts,
auf
dem
schon
vor
1665
Bier
gebraut
wurde,
gestorben
war“,
erzählt
Döllnitz’
Ortschronist
Bernd
Sinang.
Johann
Gottlieb
Goedecke,
ein
hallescher
Kaufmann
und
Besitzer
des
Gutes,
beschloss,
der
Gose
eine
Chance
zu
geben.
Mit
ihrem
Siegeszug,
der
bis
nach
Leipzig
reichen
sollte,
hatte
aber
auch
er
wohl
kaum
gerechnet.
Gose
Bier:
Für
Döllnitz
bedeutete
der
Erfolg
des
Bieres
den
Durchbruch
für
eine
ganz
besondere
Brautradition
Für
Döllnitz
bedeutete
der
Erfolg
des
Bieres
den
Durchbruch
für
eine
ganz
besondere
Brautradition:
„Im
Laufe
der
Zeit
etablierten
sich
vor
Ort
vier
Brauereien,
die
zum
Teil
eigene
Ausschänke
betrieben“,
erzählt
Bernd
Sinang.
„Zudem
wurde
die
Gose
bis
nach
Leipzig
und
Halle
vertrieben“,
ergänzt
er
stolz.
Das
neuartige
Bier
war
günstig
herzustellen.
Die
Zutaten
wuchsen
auf
den
Feldern
rund
um
Döllnitz.
Die
für
die
Beheizung
der
Braupfannen
benötigte
Kohle
soll
in
einem
eigenen
Schacht
gefördert
worden
seien.
Zugute
kam
den
Döllnitzern
offenbar
auch,
dass
die
Brau-Sozietät
in
Goslar
1826
beschloss,
keine
Gose
mehr
zu
brauchen
und
Döllnitz damit ein Alleinstellungsmerkmal besaß.
Die
Gose
setzte
ihren
Siegeszug
in
ganz
Mitteldeutschland fort.
Gose
Bier:
1880
gründete
August
Müller
in
der
Elsterstraße in Döllnitz eine Brauerei
Auch
andere
wollten
vom
wirtschaftlichen
Erfolg
der
Gose
profitieren.
1880
gründete
August
Müller
in
der
Elsterstraße
in
Döllnitz
eine
Brauerei,
die
danach
mehrfach
den
Besitzer
wechselte
-
und
unter
Franz
Hanisch
schließlich
in
den
Vereinigten
Brauereien
„Germania“
aufging,
zu
der
auch
die
1899
eröffnete
Brauerei
Hädicke
gehörte.
Mit
der
Brauerei
Hanisch
und
Co.
kam
in
der
Halleschen
Straße
1911
eine
weitere
Produktionsstätte
hinzu.
Auch
während
des
Ersten Weltkriegs wurde in Döllnitz Gose gebraut.
Für
„Germania“
kam
allerdings
kurz
nach
Kriegsende
das
Aus.
Die
Produktion
wurde
auf
Kartoffelflocken
umgestellt.
1945
schloss
das
Werk
komplett.
„Auch
im
Rittergut
endete
nach
dem
Krieg
die
Tradition,
man
musste
sich
in
den
Notzeiten
eben
um
andere
Dinge
kümmern
als
um
Bier“,
erklärt
Sinang.
Einzig
der
Standort
Hallesche
Straße
hatte
Bestand,
aber
auch
nur
bis
1968.
Seit
Kriegsende
wurde
hier
unter
anderem
durch
den
Konsumgenossenschafts-
verband
jedoch
nicht
mehr
Bier
produziert,
sondern
Mineralwasser und Limonaden.
Gose Bier: Goseflaschen aus der Nachkriegszeit
Chronist
Sinang
hat
ganze
Leitz-Ordner
mit
Material
zu
den
Brauereien
gesammelt.
Einer
der
größten
Schätze
sind
allerdings
alte
Goseflaschen
aus
der
Nachkriegszeit,
die
in
einem
Keller
schlummern.
Noch
ohne
Etikett,
stattdessen
mit
Prägung
auf
dem
Glas,
dokumentieren
sie
ein
Stück
-
oder
besser
gesagt
Schluck
-
Industriegeschichte,
die
viele
längst
vergessen haben. (mz)
Dieser Artikel wurde verfasst von Michael Bertram
Der beitrag „ Obergäriges Bier aus dem Saalekreis:
Der Siegeszug der Gose begann in Döllnitz“ stammt
von der Mitteldeutschen Zeitung 15.07.2018 .

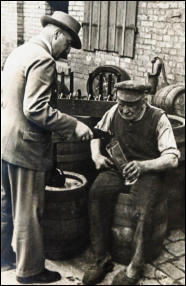



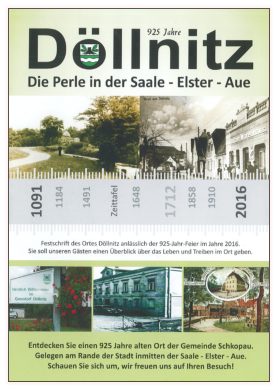
Mit einem Klick auf das Bild,
„ 925 Jahre Döllnitz „
öffnet sich ein PDF
Dokument, was mit dem
Adobe Reader, lesbar ist.

Erstellt 2016,
Herrausgeber : Ortschaftsrat Döllnitz
Text, gestaltung und Redaktion: Günter Sachse
Grafik und Layout : Angelika Röder
Diese Bilder wurden durch unseren
Chronisten Herr B.Sinag aus Döllnitz bereitgestellt.
Diese Bilder wurden durch unseren
Chronisten Herr B.Sinag aus Döllnitz bereitgestellt.
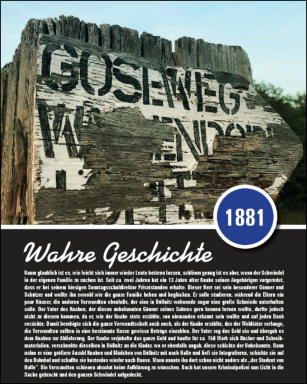
Eine Wahre Geschichte von 1881 „ Goseweg „
Kaum glaublich ist es, wie leicht sich immer wieder Leute betren lassen, schlimm genug ist es aber, wenn der
Schwindel in der eigenen Familie zu suchen ist. Seit ca. zwei Jahren hat ein 13 Jahre alter Knabe seinen Angehrigen
vorgeredet, dass er bei seinem hiesigen Sonntagsschuldirektor Privatstunden erhalte. Dieser Herr sei sein besonderer
Gnner und Schtzer und wollte ihn sowohl wie die ganze Familie heben und beglcken. Er solle studieren, whrend die
Eltern ein paar Huser, die anderen Verwandten ebenfalls, der eine in Dllnitz wohnende sogar eine groe Schmiede
unterhalten solle. Der Vater des Knaben, der diesen unbekannten Gnner seines Sohnes gern kennen lernen wollte,
durfte jedoch nicht zu diesem kommen, da er, wie der Knabe stets erzhlte, von niemanden erkannt sein wollte und
auf jeden Dank verzichte. Damit beruhigte sich die ganze Verwandtschaft auch noch, als der Knabe erzhlte, das der
Wohltter verlange, die Verwandten sollten in eine bestimmte Kasse gewisse Betrge einzahlen. Der Vater zog das Geld
ein und bergab es dem Knaben zur Ablieferung. Der Knabe verjubelte das ganze Geld und kaufte fr ca. 150 Mark sich
Bcher und Schreibmaterialien, verschenkte dieselben in Dllnitz an die Kinder, wo er ebenfalls angab, diese schickte
der Unbekannte. Dann nahm er eine grere Anzahl Knaben und Mdchen von Dllnitz mit nach Halle und lie sie
fotografieren, schickte sie auf den Bahnhof und schaffte sie kostenlos wieder nach Hause. Mann nannte ihn dort
schon nicht anders als „der Student von Halle“. Die Verwandten schienen absolut keine Aufklrung zu wnschen. Doch
hat unsere Kriminalpolizei nun Licht in die Sache gebracht und den ganzen Schwindel aufgedeckt.
Meldung vom 08.03.1881 und erschien im Halleschen Tageblatt am 10.03.1881
Ausführung unseres Chronisten Bern Sinang
Nachlesbar im „ Döllnitzer Kalender „ Ausgabe 2020
Das Wappen der Gemeinde Döllnitz
Historische Begründung
Das Wappen ist geteilt in Silber und Grün. Auf das silberne
obere Feld ist ein schwarzer Wurzelkopf aufgelegt, von
dem rechts und links seitlich und diagonal nach oben 4
lappige grüne Eichenblätter ausgehen.
Das untere grüne Feld ist mit einem silbernen Wellenband
belegt ( waagerecht ).
Die Darstellung der abgeschlagenen Eiche, die wieder neu
ausschlägt, ist als Symbol für die Wiederbelebung
Deutschlands nach 1918 bekannt ( s. Briefmarken zum
Nationalkongress 1919 ).
Als Siegel wurde dieses Symbol seitens der Gemeinde
Döllnitz ab Ende 1996 geführt.
Das silberne Wellenband ist ein Verweisen auf diese
Gemarkung berührende Weiße Elster.
Die Farben Silber und Grün verweisen auf die historische
Zugehörigkeit zu Sachsen.

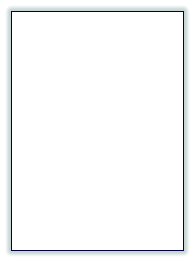
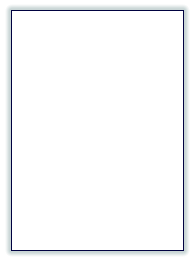
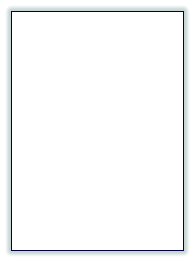
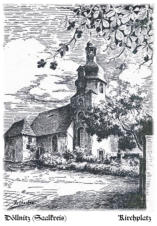




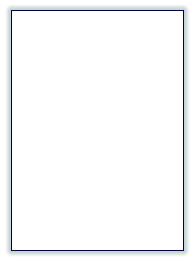
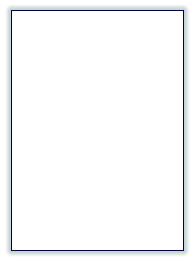
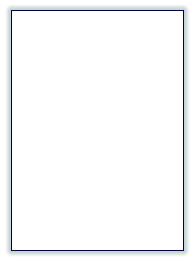
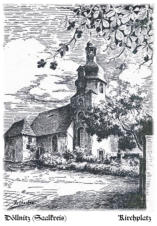


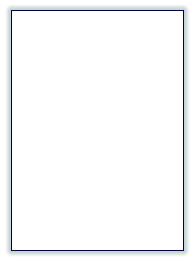
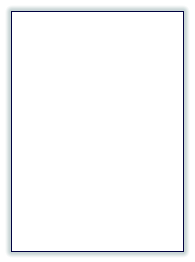
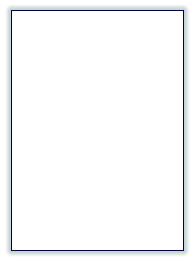
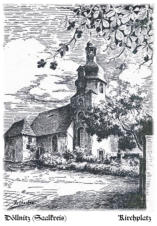


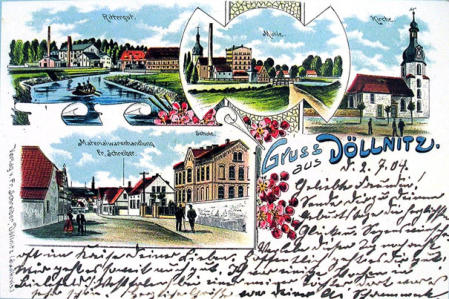

Alte Postkarten aus Döllnitz - Eine Sammlung von Günter Kurz und Bernd Sinang
Postkarte aus Döllnitz (Sammlung: Günter Kurz)
Mit der Veröffentlichung
historischer Postkarten erinnern
wir nun schon eine geraume Zeit
daran, wie es in den Dörfern des
südlichen Saalekreises einst
aussah. Diesmal zeigen wir
Ansichtskarten aus der
Schkopauer Ortschaft Döllnitz, die
im Jahr 1091 erstmals urkundlich
erwähnt wurde. Die Postkarten
stammen aus der Sammlung von
Günter Kurz, Ortchronist Bernd
Sinang hat die passenden
Informationen zusammengetragen.

Postkarte aus Döllnitz (Sammlung: Günter Kurz)
„Im Jahr 1991 beging Döllnitz seine
900-Jahr-Feier. Seit 1445 bis 1815
trennte eine Grenze den Ort. Das
Oberdorf gehörte zum Hochstift
Merseburg (Sachsen), das
Unterdorf zum Erzbistum
Magdeburg (Preußen). Seit 1824
bis 1947 wurde in Döllnitz Gose
gebraut. Um 1909 gab es vier
Brauereien und zwei Mälzereien
im Ort, auch fünf Gasthöfe. In den
drei Schulen war 1948 die
Schülerzahl auf 455 angestiegen.“
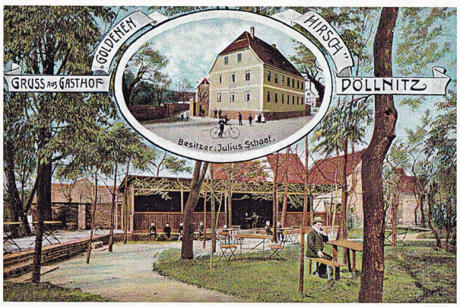
Postkarte aus Döllnitz (Sammlung: Günter Kurz)